
Cybersicherheit: Schutz für die digitale Welt
Veröffentlicht am 28. August 2025
Cybersicherheit betrifft uns alle: Schon lange ist der Schutz von IT-Infrastrukturen absolut notwendig. Der rasante technologische Fortschritt und die zunehmend instabile weltpolitische Lage schaffen zudem immer neue Angriffsflächen für Cyberkriminelle. Cybersicherheit ist daher weit mehr als eine technische Notwendigkeit – sie bildet die Grundlage dafür, dass unsere Gesellschaft digital selbstbestimmt und sicher agieren kann.
Cyberbedrohungen zählen mittlerweile zu den größten Risiken für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft – und ihre Zahl wie auch ihre Komplexität nehmen weiter zu. Ransomware-Attacken, gezielte Cyberangriffe auf Kritische Infrastrukturen (KRITIS) und weitere für die Wirtschaft und den Staat relevante Unternehmen sowie professionell organisierte Cyberkriminalität stellen Behörden und Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Um in einer zunehmend vernetzten Welt handlungsfähig und sicher zu bleiben, wird es deshalb immer wichtiger, sich mit den Grundlagen, Anwendungsfeldern und der Bedeutung von Cybersicherheit und Cyberresilienz auseinanderzusetzen. Mit dem fundierten Überblick der Bundesdruckerei über zentrale Begriffe, aktuelle Entwicklungen und rechtliche Vorgaben bieten wir Ihnen Orientierung in einem vielschichtigen Handlungsfeld.
Was bedeutet Cybersicherheit?
Cybersicherheit umfasst alle technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, um vernetzte Systeme, Daten und Kommunikationswege vor digitalen Angriffen zu schützen. Effektive Maßnahmen, um Cybersicherheit zu gewährleisten, verhindern nicht nur unbefugten Zugriff. Sie stellen zudem sicher, dass Daten unverfälscht bleiben, die Vertraulichkeit geschützt wird und sie bei Bedarf zuverlässig zur Verfügung stehen.

Wichtig ist eine Abgrenzung zu den Begriffen Informationssicherheit und IT-Sicherheit: Informationssicherheit umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Informationen – unabhängig davon, ob sie digital oder analog vorliegen. IT-Sicherheit konzentriert sich auf den Schutz der technischen Infrastruktur, also der Hard- und Software. Bei der Cybersicherheit hingegen stehen digitale Prozesse und Systeme im Vordergrund.
Dazu zählen alle miteinander verbundenen digitalen, organisatorischen und personellen Sicherheitsmaßnahmen und Komponenten, die zusammenarbeiten – etwa vernetzte Computer, Online-Dienste, Datenbanken und intelligente Geräte im Internet of Things (IoT). Die zunehmende Komplexität und Vernetzung dieser Systeme macht Cybersicherheit zu einem zentralen Thema für Unternehmen, Behörden und Privatpersonen.
Grundlagen der Cybersicherheit: Anwendungsgebiete und Bedeutung
Die Relevanz von Cybersicherheit erstreckt sich heute auf nahezu alle Lebensbereiche. Gesellschaftlich relevant sind unter anderem diese Sektoren:

Verwaltung: Bundesbehörden, Länder und Kommunen verwalten Bürgerdaten und betreiben Kritische Infrastrukturen. Umso wichtiger ist der Schutz hochsensibler Informationen, um das Vertrauen von Bürgern und Bürgerinnen zu bewahren sowie die öffentliche Sicherheit und den Ablauf wichtiger Dienste zu gewährleisten.

Gesundheitswesen: Mit der zunehmenden Digitalisierung von Gesundheitsdaten und medizinischen Geräten wächst die Bedeutung der Cybersicherheit im Gesundheitssektor. Hier können Sicherheitslücken nicht nur zu Datenschutzverletzungen führen, sondern schlimmstenfalls Menschenleben gefährden.
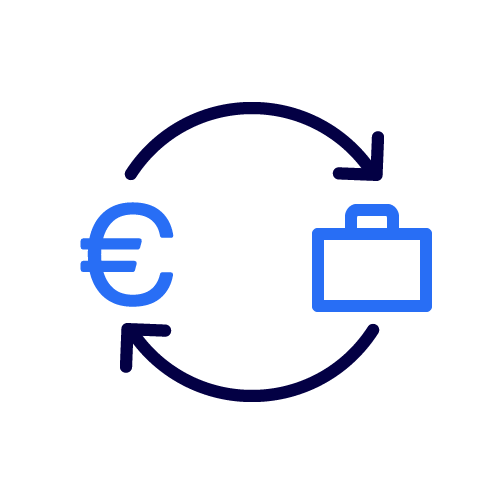
Wirtschaft: Unternehmen müssen ihr geistiges Eigentum sowie ihre Geschäftsgeheimnisse, Kundendaten und digitalen Prozesse vor Cyberangriffen wie Ransomware schützen. Ein erfolgreicher Cyberangriff kann existenzbedrohende finanzielle Schäden verursachen und das Kundenvertrauen nachhaltig erschüttern.
Digitale Souveränität – ein zentraler Baustein der Cybersicherheit
Ein wichtiger Aspekt der Cybersicherheit ist die digitale Souveränität. Sie beschreibt die Fähigkeit, im digitalen Raum selbstbestimmt zu handeln und unabhängige Entscheidungen zu treffen. Der Begriff umfasst sowohl die technologische Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern oder Technologien als auch die Kontrolle über die eigenen Daten und digitalen Prozesse. Das heißt auch, dass Staaten und Organisationen die für sie nötigen Technologien beherrschen, um unabhängig von ausländischen IT-Unternehmen zu agieren.
Digitale Souveränität und Cybersicherheit bedingen sich dabei gegenseitig. Ohne eine starke Cybersicherheit kann ein Staat oder eine Organisation Daten, Infrastrukturen und Interessen nicht effektiv schützen. Umgekehrt schafft digitale Souveränität die notwendigen Rahmenbedingungen, um eine effektive Cybersicherheit zu gewährleisten und die digitale Selbstbestimmung zu stärken. Beide Konzepte sind also für die Bundesrepublik Deutschland und somit die Bundesdruckerei als Technologieunternehmen des Bundes untrennbar miteinander verbunden und müssen gemeinsam betrachtet werden, um eine sichere und souveräne digitale Zukunft zu gestalten.
Aktuelle Herausforderungen und Bedrohungen für die Cybersicherheit
Cybersicherheit ist heute wichtiger denn je, denn die Bedrohungslage im Cyberraum hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft – zuletzt durch die geopolitische Situation. Zudem bringen neue Technologien neue Risiken mit sich, während auch Kriminelle ihre Methoden kontinuierlich weiterentwickeln. Die finanziellen Schäden durch Cyberkriminalität sind enorm: Allein durch Ransomware wurden 2024 weltweit Lösegelder in Höhe von über 1,1 Milliarden US-Dollar erpresst.
Auch die Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) wächst im Bereich Cybersicherheit stetig. Das Besondere: KI spielt hier eine ambivalente Rolle. Einerseits ermöglicht sie immer ausgefeiltere Angriffe mit schwerwiegenden Auswirkungen, andererseits bietet sie neue Möglichkeiten zur Verteidigung. Denn KI-basierte Sicherheitssysteme können Anomalien frühzeitig erkennen, Angriffsmuster identifizieren und automatisierte Abwehrmaßnahmen einleiten. Ein Beispiel hierfür ist ein KI-gestütztes Secure E-Mail-Gateway zum Schutz vor E-Mail-basierten Angriffen wie die Lösung genumail von der genua GmbH, einem Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe.
Während Künstliche Intelligenz also Chancen wie Risiken birgt, existieren unzählige weitere Cyberbedrohungen, die Einzelpersonen, Unternehmen sowie staatliche Institutionen ins Visier nehmen und bestehende Cybersicherheitsarchitekturen und lösungen kontinuierlich auf die Probe stellen:

Bedrohung der Cybersicherheit durch Ransomware und Malware

Die menschliche Schwachstelle: Social Engineering
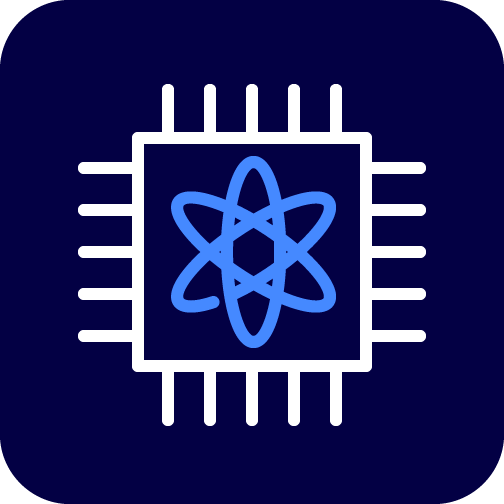
Angriffe durch Quantencomputer
Bedrohung der Cybersicherheit durch Ransomware und Malware
Malware ist ein Oberbegriff, der eine Vielzahl verschiedener Schadsoftware umfasst, darunter Viren, Trojaner, Würmer und Ransomware. Letztere ist Schadsoftware, die Daten verschlüsselt, damit im Anschluss Lösegeld für die Entschlüsselung gefordert werden kann. Malware-Angriffe verfolgen in der Regel das Ziel der finanziellen Erpressung, des Datendiebstahls oder der Sabotage, indem sie beispielsweise Passwörter ausspähen, Systeme manipulieren oder unbemerkt im Hintergrund agieren, um sensible Informationen abzufangen.
Besonders betroffen von Ransomware-Angriffen sind nicht zuletzt jene Unternehmen, die Teil Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) sind. 2024 erhielt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 726 Meldungen von Störungen aufgrund von Cyberangriffen, die zu einem Ausfall oder zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der KRITIS geführt haben oder führen können. Im Jahr zuvor waren es noch 490 Meldungen gewesen.
Die menschliche Schwachstelle: Social Engineering
Social Engineering bezeichnet den Versuch, Menschen dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben oder Handlungen auszuführen, die die digitale Cybersicherheit gefährden. Auf diese Weise wollen Angreifende Daten stehlen, Zugang zu geschützten Systemen erhalten oder Vorgänge sabotieren. Dafür bringen sie ihre Opfer dazu, sensible Daten offenzulegen, Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen oder schädliche Programme auf privaten Geräten oder Firmencomputern zu installieren.
Phishing ist eine bekannte Form des Social Engineerings. Dabei geben sich Kriminelle als vertrauenswürdige Personen oder Institutionen aus, um an sensible Informationen wie Passwörter oder Kreditkartendaten zu gelangen. Die Angriffsmethoden sind vielfältig und reichen von gefälschten E-Mails bis hin zu manipulierten Websites. Ein weiteres klassisches Beispiel für Social Engineering: Die Mail vom vermeintlichen Chef, der dringend Geld vom Firmenkonto braucht und um eine schnelle Überweisung bittet.
Angriffe durch Quantencomputer
Ein Quantencomputer verarbeitet Informationen mit sogenannten Qubits, die im Gegensatz zu klassischen Bits nicht nur die Zustände 0 oder 1, sondern auch Überlagerungen (Superpositionen) einnehmen können. Auf diese Weise können Quantencomputer bestimmte komplexe Probleme deutlich schneller lösen als klassische Computer. Dies birgt jedoch auch Gefahren für die Cybersicherheit, da Quantencomputer künftig in der Lage sein werden, aktuell sichere Verschlüsselungsalgorithmen zu knacken.
Die Bedrohung ist schon heute real und muss ernst genommen werden. Daten, die bisher als sicher verschlüsselt galten, könnten bereits jetzt ausgespäht und – nach Verfügbarkeit entsprechender Quantentechnik – gebrochen werden.
Die Abwehr von Angriffen durch Quantencomputer steht deshalb bereits heute im Fokus der Post-Quantum-Kryptografie, eines Forschungsgebiets, das zunehmend an Bedeutung gewinnt und bereits seit Jahren von der Bundesdruckerei-Gruppe aktiv geformt wird. Schon heute arbeiten Wissenschaft, Unternehmen und staatliche Institutionen mit Hochdruck an der Entwicklung von Verschlüsselungs- und Signaturmethoden, die auch gegen die enormen Rechenkapazitäten von Quantencomputern bestehen können und eine mögliche Bedrohungslage so gar nicht erst entstehen lassen.
Während die Forschung an quantenresistenten Verschlüsselungsmethoden voranschreitet, entwickelt sich der rechtliche Rahmen für die Cybersicherheit kontinuierlich weiter. Dieser legt gesetzliche Anforderungen fest und unterstützt Organisationen bei der Implementierung wirksamer Schutzmaßnahmen.
Darüber hinaus erarbeitet das BSI konkrete Empfehlungen, wie mit den Herausforderungen durch Quantencomputer umgegangen werden sollte.
Gesetzliche Grundlagen der Cybersicherheit
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Cybersicherheit bilden die Grundlage für verbindliche Sicherheitsstandards und -maßnahmen. Auf EU-Ebene sind aus Unternehmenssicht vor allem der Cyber Resilience Act und die NIS-2-Richtlinie relevant.
- Der Cyber Resilience Act verpflichtet die Hersteller von vernetzten Produkten, über den gesamten Lebenszyklus Cybersicherheitsmaßnahmen zu implementieren. Darunter fallen beispielsweise die Einführung eines Risikomanagementsystems, regelmäßige verpflichtende Updates sowie das Beheben von Schwachstellen. Ziel ist dabei, die Produktsicherheit mit digitalen Elementen zu verbessern und so das Vertrauen der Verbraucher und Verbraucherinnen zu stärken. Erste Vorgaben gelten von Juni 2026 an, spätestens bis Dezember 2027 ist der Cyber Resilience Act in Gänze umzusetzen.
- Die NIS-2-Richtlinie (kurz für: Network and Information Security) erweitert seit ihrem Inkrafttreten im Januar 2023 den Anwendungsbereich der ursprünglichen NIS-Richtlinie und verschärft die Anforderungen an die Cybersicherheit Kritischer Infrastrukturen. Nach der zu erwartenden Umsetzung in das nationale Recht verpflichtet sie Unternehmen und Organisationen in wichtigen Sektoren zu umfassenden Sicherheitsmaßnahmen und legt Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen fest. Zu den Kritischen Infrastrukturen zählen beispielsweise die Sektoren Energieversorgung, Gesundheits- und Finanzwesen, Transport und Verkehr sowie die Wasser- und Lebensmittelversorgung.
- Eine weitere wichtige Vorgabe ist die Critical Entities Resilience Directive (CER). Die 2022 verabschiedete EU-Richtlinie zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit Kritischer Infrastrukturen in Europa zu stärken. Sie fordert Risikobewertungen, Sicherheitsmaßnahmen und Meldepflichten für Vorfälle, die den Betrieb dieser Einrichtungen gefährden könnten. Im Gegensatz zur NIS-2-Richtlinie, die sich speziell auf Cybersicherheit konzentriert, umfasst CER auch die physische Sicherheit und allgemeine Resilienz.
- Ein deutsches KRITIS-Dachgesetz wird die europäischen Vorgaben national umsetzen und erweitert den Schutz Kritischer Infrastrukturen. Das Gesetz schafft erstmals eine sektorenübergreifende bundesgesetzliche Regelung zum physischen Schutz Kritischer Infrastrukturen in Deutschland.
- Auf nationaler Ebene existiert außerdem das IT-Sicherheitsgesetz des Bundes. Im Jahr 2015 verabschiedet und mehrfach novelliert, verpflichtet es Betreiber Kritischer Infrastrukturen und digitaler Dienste, angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer IT-Systeme zu implementieren.
Damit aber alle Maßnahmen greifen und verzahnt werden können, empfiehlt das BSI die Implementierung eines Informations- und Cybersicherheitsmanagementsystems (ISMS).
Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung von Cybersicherheit
Beim Thema Cybersicherheit gilt grundsätzlich: Prävention ist günstiger als Reaktion. Denn oftmals kostet es wesentlich mehr, nach einer Cyberattacke Systeme wiederherzustellen, rechtliche Konsequenzen zu bewältigen oder gar den eigenen Ruf retten zu müssen, als in den Schutz vor Cyberbedrohungen zu investieren – Maßnahmen, die in einer Strategie sorgfältig aufeinander abgestimmt sein müssen.

Grundsätzlich gilt: Eine effektive Cybersicherheitsstrategie erfordert immer einen zweistufigen Ansatz. Diese zweistufige Vorgehensweise sieht vor, dass Netzwerke geschützt werden und parallel auch die Daten innerhalb des Netzwerks. Um konkrete Schutzmaßnahmen wirksam zu implementieren, braucht es außerdem ein umfassendes Verständnis für die Grundprinzipien der Cybersicherheit beziehungsweise Cyberresilienz und die Implementierung eines Informations- und Cybersicherheitsmanagementsystems (ISMS).
Zu den darin enthaltenen organisatorischen und technischen Maßnahmen gehören unter anderem:
- Risikoanalyse und -management
Im ersten Schritt gilt es, die Basis für gezielte Schutzmaßnahmen zu legen, indem die jeweilige Organisation potenzielle Bedrohungen sowie Schwachstellen systematisch identifiziert und bewertet. Das passiert beispielsweise im Rahmen eines IT-Sicherheitsaudits. - Technische Schutzmaßnahmen
Hierzu gehören Firewalls & Gateways, sichere VPN-Lösungen, Systeme zur Angriffserkennung (statt Intrusion-Detection-Systeme), Datendioden, abgesicherte Fernwartung sowie Verschlüsselungs- und Authentifizierungstechnologien. - Organisatorische Maßnahmen
Dazu zählen beispielsweise Sicherheitsrichtlinien und Zugriffskontrollen. Richtlinien definieren verbindliche Standards und Prozesse für den Umgang mit IT-Systemen und sensiblen Daten. Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisierte Personen auf bestimmte Ressourcen zugreifen können, etwa durch Berechtigungskonzepte. Prozesse zur Behandlung von Sicherheitsvorfällen und Notfallpläne können darüber hinaus festlegen, wie im Fall einer Cyberattacke zu reagieren ist, um Schäden zu minimieren und den Normalbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. -
Awareness und Schulung
Da der Mensch oft das schwächste Glied in der Sicherheitskette ist, sind regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen unerlässlich. Die spezifischen Anforderungen an Cybersicherheit variieren je nach Branche.Mit der DORA-Verordnung hat die Europäische Union ein einheitliches Regelwerk zur Stärkung der digitalen Resilienz von Unternehmen im Finanzsektor geschaffen. Die Verordnung adressiert sowohl Finanzinstitute als auch deren kritische IKT-Dienstleister. Als unmittelbar geltendes EU-Recht unterscheidet sich DORA grundlegend von der NIS-2-Richtlinie, die durch nationale Umsetzungsgesetze konkretisiert werden muss. Aufgrund ihres sektorspezifischen Charakters ist DORA vorrangig gegenüber NIS-2, weshalb der Bankensektor explizit nicht in den Anwendungsbereich der NIS-2 fällt.
Industrieunternehmen wiederum müssen vor allem ihre Produktionsanlagen und so geistiges Eigentum schützen. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte erfordern maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte, die sowohl den regulatorischen Rahmen als auch die spezifischen Bedrohungsszenarien der jeweiligen Branche berücksichtigen.
Cybersicherheitsstrategien für Unternehmen
Cyberangriffe bedrohen sensible Daten, Geschäftsgeheimnisse und die Betriebsfähigkeit von Unternehmen. Um Cybersicherheit zu gewährleisten, sind sowohl technologische als auch organisatorische Aspekte mitzudenken und in einer Cybersicherheitsstrategie zu formulieren.
Cybersicherheitsstrategien im Gesundheitswesen
Gesundheitseinrichtungen stellen eine Infrastruktur dar, bei der Cyberangriffe unmittelbar Menschenleben gefährden können, etwa wenn Behandlungen verzögert oder medizinische Geräte manipuliert werden. Die fortschreitende Digitalisierung mit elektronischen Patientenakten und vernetzten Medizingeräten vergrößert die potenzielle Angriffsfläche kontinuierlich. In diesem Kontext spielt die Telematikinfrastruktur eine zentrale Rolle als sicheres Netzwerk für das deutsche Gesundheitswesen. Sie verbindet unter anderem Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken und Krankenkassen und ermöglicht den Austausch von Gesundheitsdaten.
Cybersicherheitsstrategien in der Verwaltung
Öffentliche Verwaltungen arbeiten mit sensiblen Bürgerdaten und betreiben Kritische Infrastrukturen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Behörden auf ein ganzheitliches Sicherheitskonzept setzen, das technische, organisatorische und personelle Maßnahmen umfasst. Zentral ist dabei die Einführung sicherer Authentifizierungsverfahren mit mehrstufigen Verifikationsprozessen und digitalen Identitäten für Mitarbeitende. Datenverschlüsselung und granulare Zugriffskontrollen bilden weitere Schutzmechanismen. Die Bundesdruckerei-Gruppe bietet speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung zugeschnittene Cybersicherheitslösungen an, die sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz digitaler Verwaltungsprozesse fördern. Darunter sind Anwendungen für sichere digitale Identitäten für Behördenmitarbeitende und BSI-konforme Lösungen für den Umgang mit VS-NfD-Verschlusssachen.



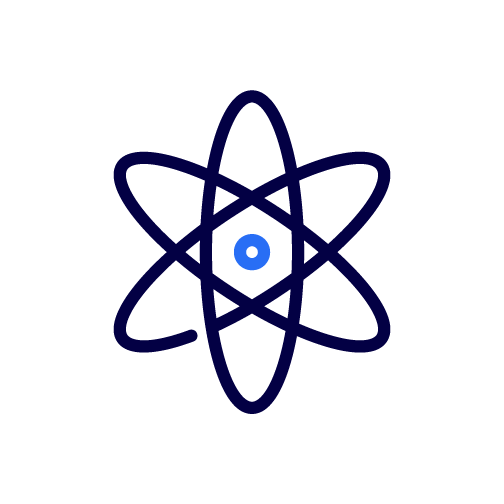
Konzepte zum Schutz vor Cyberangriffen
Die zunehmende Komplexität und Dynamik digitaler Bedrohungen erfordert zuverlässige und innovative Ansätze, um Cybersicherheit effektiv zu gewährleisten. Dabei geht es nicht nur darum, bestehende Systeme zu schützen, sondern auch darum, ein Sicherheitsbewusstsein zu etablieren und Strategien für die Zukunft zu entwickeln, die wachsenden Anforderungen gerecht werden. Diese vier Konzepte tragen wesentlich dazu bei, digitale Infrastrukturen und Daten nachhaltig abzusichern:
Cybersicherheit erlangen durch Zero Trust
Das Zero-Trust-Modell basiert auf dem Grundsatz „Vertraue niemandem, überprüfe alles“. Es geht davon aus, dass Bedrohungen sowohl von außen als auch von innen kommen können und jeder Zugriff auf Ressourcen streng kontrolliert werden muss. Dieses Konzept umfasst:
- Kontinuierliche Authentifizierung und Autorisierung.
- Mikrosegmentierung von Netzwerken. Darunter versteht man die Aufteilung eines Netzwerks in viele kleine, voneinander isolierte Bereiche. Jeder Bereich verfügt über eigene Sicherheitsregeln, die genau festlegen, welcher Datenverkehr erlaubt ist. Das verhindert, dass sich Angreifende, die in einen Teil des Netzwerks eingedrungen sind, frei im gesamten System bewegen können.
- Prinzip der geringsten Berechtigung (auch bekannt als „Principle of Least Privilege“ oder „PoLP“). Es besagt, dass Nutzenden nur die Zugriffsrechte und Berechtigungen gewährt werden sollten, die zur Erfüllung der Aufgaben unbedingt erforderlich sind. Die Folge: Kompromittierte User können durch eingeschränkte Rechte nur in einem bestimmten Bereich Schaden anrichten.
- Umfassende Überwachung und Protokollierung.
Ein Beispiel aus der Praxis: Die Telematikinfrastruktur 2.0 wird das Zero-Trust-Prinzip implementieren – etwa, indem sie Authentifizierung und Autorisierung für jeden Zugriff auf Gesundheitsdaten fordert, unabhängig davon, ob der Zugriff aus dem internen Netzwerk oder von außerhalb erfolgt.
Identitätsmanagement als Schlüssel zur Sicherheit
Entscheidend für Cybersicherheit ist ebenfalls ein effektives Identitätsmanagement: Es stellt sicher, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Daten und Systeme erhalten. Sichere digitale Identitäten bilden dabei das Fundament für vertrauenswürdige digitale Interaktionen, da sie die eindeutige Identifizierung von Nutzern und Nutzerinnen im digitalen Raum ermöglichen und so Identitätsbetrug vorbeugen. Moderne Konzepte wie die European Digital Identity Wallet (EUDI-Wallet) geben Usern zudem mehr Kontrolle über ihre digitale Identität. Eng mit dem Thema digitale Identitäten verknüpft sind elektronische Zertifikate und die von der eIDAS-Verordnung definierten Vertrauensdienste. Personenzertifikate dienen dazu, Identitäten bei der E-Mail-Kommunikation oder beim Zugriff auf Netzwerke eindeutig zu bestätigen. TLS-SSL-Website-Zertifikate belegen, wer hinter einem Internetauftritt steht. Maschinenzertifikate wiederum authentifizieren Geräte und tragen so entscheidend dazu bei, Vertrauen im Internet of Things (IoT) sowie in Industrie-4.0-Anwendungen zu schaffen.
Die D-Trust GmbH, ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe, ist ein führender Anbieter von Lösungen für Sichere Identitäten und trägt so maßgeblich zur Stärkung der Cybersicherheit bei.
Cybersicherheit dank sicherer Cloud-Lösungen
Cloud Computing bietet zahlreiche Vorteile, birgt jedoch auch spezifische Risiken. Sichere Cloud-Lösungen kombinieren technische Schutzmaßnahmen mit vertraglichen Regelungen und Compliance-Anforderungen. Für eine robuste Cloud-Sicherheit sind dabei mehrere Schlüsselkomponenten entscheidend: Eine starke Datenverschlüsselung sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand verhindert unbefugten Zugriff selbst bei erfolgreichen Angriffen. Moderne Authentifizierungsmechanismen wie Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisierte Nutzende auf sensible Daten zugreifen können. Besonders wichtig ist die physische Sicherheit der Rechenzentren, in denen die Cloud-Infrastruktur betrieben wird. Hier spielen Standortwahl, Zugangsbeschränkungen und Notfallpläne eine zentrale Rolle. Vertragliche Vereinbarungen zur Cybersicherheit zwischen Cloud-Kundschaft und Cloud-Anbieter formulieren die Randbedingungen für eine sichere Nutzung, beinhalten aber auch Vorsorgemaßnahmen für die Beendigung des Auftragsverhältnisses.
Quantencomputing und quantenresistente Kryptografie für Cybersicherheit
Die Entwicklung von Quantencomputern macht deutlich, dass herkömmliche kryptografische Verfahren langfristig nicht mehr ausreichen werden, um digitale Systeme und Daten vor Cyberattacken zu schützen. Quantencomputer stellen eine Cyberbedrohung dar, weil sie in der Lage sein könnten, viele der heute genutzten Verschlüsselungsverfahren in sehr kurzer Zeit zu knacken. Was heute mit klassischen Computern Millionen Jahre dauern würde, könnten Quantencomputer in Stunden oder Tagen schaffen. Damit droht der Verlust der Vertraulichkeit sensibler Daten – von staatlichen Informationen über Finanztransaktionen bis hin zu persönlichen Identitäten.
Quantencomputer werden in der Zukunft aber auch eine schnellere Analyse großer Datenmengen ermöglichen, was beispielsweise bei der Erkennung von Cyberattacken helfen wird. Sie könnten etwa Angriffsmuster in Echtzeit identifizieren und so proaktive Schutzmaßnahmen ermöglichen. Darüber hinaus bieten sie neue Möglichkeiten zur Simulation komplexer Sicherheitsszenarien, wodurch Unternehmen ihre Abwehrstrategien besser testen und optimieren können.
Von besonderer Relevanz ist außerdem die quantenresistente Kryptografie. Deren Verschlüsselungsmethoden sind speziell darauf ausgelegt, auch der Rechenleistung von Quantencomputern zu trotzen. Die quantenresistente Kryptografie ist entscheidend, um die Integrität und Vertraulichkeit sensibler Daten in der Ära der Quantencomputer zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das für Kritische Infrastrukturen wie Finanzsysteme und staatliche Einrichtungen sowie persönliche Daten in hoheitlichen ID-Dokumenten. Bereits heute wird daran gearbeitet, diese neuen Verfahren zu entwickeln und zu standardisieren, damit Unternehmen und Organisationen rechtzeitig auf die Herausforderungen des Quantenzeitalters vorbereitet sind. Cyberkriminelle hingegen arbeiten längst nach dem Prinzip „Store now, decrypt later“ – sie sammeln verschlüsselte Daten, die sie momentan nicht entschlüsseln können, um diese in der Zukunft mit Quantencomputern zu knacken. Deshalb schützt bereits heute seine Daten vor diesem Szenario, wer bereits jetzt auf Post-Quanten-Verschlüsselung umsteigt. Die Bundesdruckerei-Gruppe engagiert sich aktiv in der Forschung und Entwicklung von quantenresistenter Kryptografie. Mit innovativen Projekten und Technologien arbeitet sie daran, die Potenziale von Quanteneffekten für neue Sicherheitslösungen zu schaffen, die auch in einer Welt mit leistungsfähigen Quantencomputern Bestand haben.
So unterstützt die Bundesdruckerei-Gruppe in Sachen Cybersicherheit
Die Bundesdruckerei-Gruppe unterstützt öffentliche Institutionen und Unternehmen dabei, ihre Cybersicherheit zu stärken, und trägt so maßgeblich zur digitalen Souveränität in Deutschland bei. Mit einem umfassenden Portfolio bietet sie Lösungen für sichere Infrastrukturen sowie sichere Identitäten und Daten. Im Bereich der sicheren Infrastrukturen sind das beispielsweise Firewalls und Gateways, VPNs, Fernwartungslösungen und industrielle IT-Sicherheit.

Eine besondere Rolle spielt dabei die Bundesdruckerei-Tochter genua: Das IT-Sicherheitsunternehmen stellt zum Beispiel für Behörden und die geheimschutzbetreute Industrie BSI-zugelassene Firewalls, ein Lösungs-Bundle für den VS-NfD-konformen Arbeitsplatz und robusten Netzwerkschutz bereit – und das mit den höchsten Sicherheitsstandards und „Made in Germany“. BSI-zertifizierte Consultants zur Informations- und Cybersicherheit runden das Portfolio durch Beratungsleistungen ab. Mittlerweile liefert genua auch VS-NfD-zertifizierte Produkte für die digital souveräne IONOS Cloud. Die IONOS Cloud zeichnet sich durch ihre DSGVO-konforme, hochverfügbare Infrastruktur aus deutschem Rechenzentrumsbetrieb aus. Daher ist sie besonders für sicherheitskritische IT-Anwendungen in Behörden und Unternehmen geeignet.

Auch die jüngste Bundesdruckerei-Tochter Xecuro stellt die Bundesdruckerei-Gruppe in den Dienst der digitalen Souveränität: Das Unternehmen ermöglicht hochsichere Verschlusssachenkommunikation in der öffentlichen Verwaltung für Bund und Länder. Es ist für den Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung der entsprechenden Infrastruktur verantwortlich.
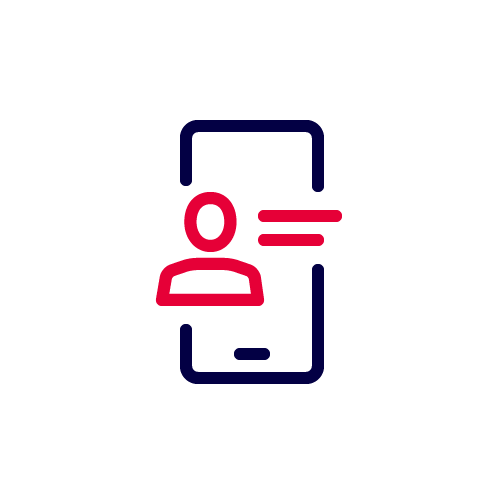
D-Trust ergänzt das Cybersicherheits-Portfolio innerhalb der Bundesdruckerei-Gruppe unter anderem mit digitalen Zertifikaten, eID-basierten Ident-Verfahren und Vertrauensdiensten. Verschlüsselungstechnologien und Smartcards von D-Trust tragen dazu bei, digitale Prozesse abzusichern und Vertrauen in die Technologie zu schaffen.

Als Technologieunternehmen des Bundes ist die Bundesdruckerei-Gruppe exzellent vernetzt. Sie trägt dabei stets sämtlichen Anforderungen der deutschen sowie europäischen Cybersicherheitsgesetzgebung Rechnung und kombiniert innovative Produkte mit kompetenter Beratung und zukunftsweisender Forschung. Selbst bei Zukunftsthemen wie der Post-Quanten-Kryptografie befindet sich die Bundesdruckerei-Gruppe bereits in der Umsetzung. Unsere Kundschaft ist so schon heute für die Angriffe von morgen gewappnet.
Cybersicherheit als gemeinschaftliche Aufgabe für eine vernetzte Welt
Cybersicherheit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Sie erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit und Investitionen, um den Cyberbedrohungen im digitalen Raum zu begegnen und entgegenzuwirken. Neue Technologien wie KI, Quantencomputing und die wachsende Nutzung von Cloud-Diensten bieten sowohl Chancen als auch Herausforderungen und werden zukünftig immer neue Maßnahmen für erfolgreiche Cybersicherheit erfordern.
Der Schutz unserer digitalen Infrastruktur lässt sich jedoch nicht allein durch technische Lösungen gewährleisten – er verlangt vielmehr ein koordiniertes Zusammenspiel auf allen Ebenen. Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Einzelpersonen müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen und ein Bewusstsein für die Bedeutung von Cybersicherheit entwickeln. Dies bedeutet nicht nur die Implementierung technischer Schutzmaßnahmen, sondern auch die Förderung einer Sicherheitskultur, in der jeder einzelne Mensch seinen Beitrag leistet. Regelmäßige Schulungen, der offene Austausch über Sicherheitsvorfälle und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, sind dabei entscheidende Faktoren.

Das Anliegen jedes und jeder Einzelnen sollte es sein, ein Sicherheitsbewusstsein im digitalen Raum zu entwickeln.
Des Weiteren ist eine enge Zusammenarbeit auf nationaler wie internationaler Ebene gefordert: Staaten, Sicherheitsbehörden und Privatwirtschaft müssen gemeinsame Standards entwickeln und durchsetzen, um grenzüberschreitende Cyberangriffe effektiv abzuwehren und eine sichere digitale Welt für alle zu gewährleisten.
Nur ein gemeinsames Vorgehen stärkt die Resilienz unserer vernetzten Welt und erhält das Vertrauen in digitale Technologien.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Cybersicherheit
Was versteht man unter Cybersicherheit?
Cybersicherheit umfasst alle Maßnahmen, die digitale Systeme, Netzwerke und Daten vor unbefugtem Zugriff, Manipulation oder Zerstörung schützen. Sie zielt darauf ab, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu gewährleisten.
Wie unterscheiden sich Cybersicherheit und IT-Sicherheit?
IT-Sicherheit konzentriert sich auf den Schutz von Hardware und Software, während Cybersicherheit einen breiteren Fokus auf digitale Prozesse und Systeme legt. Cybersicherheit kann als Teilbereich der umfassenderen Informationssicherheit betrachtet werden.
Für wen ist Cybersicherheit wichtig?
Cybersicherheit ist für alle relevant, die digitale Technologien nutzen – von Privatpersonen über Unternehmen bis hin zu staatlichen Einrichtungen. Besonders kritisch ist sie für Betreiber Kritischer Infrastrukturen und Organisationen, die sensible Daten verarbeiten.
Welche gesetzlichen Anforderungen gelten in Deutschland zur Cybersicherheit?
In Deutschland sind insbesondere das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz 2.0) sowie das NIS-2-Umsetzungsgesetz relevant. Für Kritische Infrastrukturen sind die KRITIS-Verordnung und das im Koalitionsvertrag verankerte KRITIS-Dachgesetz zu beachten. Mit dem Cyber Resilience Act hat die EU zudem im Jahr 2024 eine Verordnung erlassen, die alle Produkte mit digitalen Elementen im europäischen Binnenmarkt betrifft.




